Hier folgt eine Predigt
Berachtung
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Liebe Brüder und Schwestern treten wir in der Einheit des Heiligen Geistes zum Altar Gottes, der uns erfreut von Jugend an. Verneigen wir uns in Anbetung vor Gott, unserem Vater dem Vater und Schöpfer, dem Sohn unserem Erlöser, und dem Heiligen Geist unserem Tröster und Beistand. DIR Allmächtiger und ewiger Gott verdanken wir alles, was wir sind und haben. DIR allein gebührt Lob Dank und Herrlichkeit allezeit und in Ewigkeit.
Bekennen wir vor dem lebendigen ewig gegenwärtigen Herrn und Gott mit der Bitte um Vergebung, all unsere Schuld: Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, der seligen allzeit reinen Jungfrau Maria, allen Engeln und Heiligen und Euch Brüdern und Schwestern, dass ich in meinem Leben viel gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken,
durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine übergroße Schuld. Darum bitte ich die allerseligste Jungfrau Maria, alle Heiligen, Engel und Euch ihre Brüder und Schwestern, für mich und uns zu beten bei Gott unserem Herrn. Der Allmächtige Dreifaltige Gott erbarme sich unser und vergebe uns die Schuld und Sünde.
Jesus Christus der Gottessohn, hat aus Liebe zum Vater unsere Menschennatur angenommen, von der Liebe des Vaters
Kunde gebracht, uns durch SEIN Leben, den Tod und die Auferstehung, von Sünde und Schuld erlöst, zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott in der Kirche befreit, und uns als Erben Gottes, das ewige Leben zugesagt. Als Söhne, Töchter und Kinder Gottes, bringen wir im Gottesdienst auf allen Altären der weltweiten Kirche, uns selbst mit allem was wir sind und haben, dem Vater Sohn und Heiligen Geist in unseren Gebeten, Bitten und Opfergaben dar. Wir vereinigen uns
vor Jesus Christus, der makellosen Opfergabe, mit Maria unserer Mutter, allen Engeln und Heiligen, der Kirche und mit allen Geschöpfen in Gottes Universum der Liebe. Jesus Christus ist unser Weg die Wahrheit und der Weg zum ewigen Leben. IHM, der in der Einheit des Heiligen Geist in unseren Herzen, der Kirche und in allen Geschöpfen wohnt, sei allezeit und ewig Lob, Dank und Herrlichkeit.
Lasset uns mit IHM zu IHM und durch IHN zu SEINEM Gedächtnis beten: Am Abend vor SEINEM Leiden nahm der Herr Jesus Christus Brot in SEINE Hände, dankte, brach und segnete es und sprach: „Nehmet und esset alle davon das ist mein Leib der für Euch hingegeben wird.“ Ebenso nahm ER nach dem Mahle den Kelch, dankte wiederum reichte ihn SEINEN Jüngern mit den Worten: „Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für Euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Bitten wir um den Beistand des Heiligen Geistes, dass Jesus Christus, der Gottes-und Menschensohn, auch unseren Leib und unser Blut Gott zur Vergebung der Sünden darbringen kann.
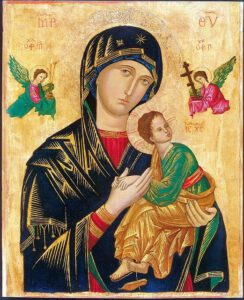
Dankgebet
Alles was ich bin und habe, was wir sind und haben, und was es im Universum und auf unserer Welt gibt, verdanken wir DIR Vater, Sohn und Heiliger Geist. Durch DICH in DIR und mit DIR, hat alles was es gibt Bestand Ordnung und Ziel. DU hast uns im Mutterschoß gebildet, Leben und Atem geschenkt, und für alles gesorgt, was wir zum Leben brauchen. In den Familien und in der Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern hast DU uns Geborgenheit geschenkt und im Geben und Nehmen unterwiesen. DIR verdanken wir die vielen Menschen, die unseren Lebensweg begleiteten, und mit allem versorgten, was bis zum heutigen Tag zum Leben erforderlich war und nötig ist.
DU wunderbarer Gott, hast uns in die Gemeinschaft DEINER Kirche aufgenommen, und mit DEINEN Liebesgaben und Gnaden reich beschenkt. Staunen nur können wir, und betend DIR danken, dass es DICH und die Fülle DEINER Werke, Gaben und Gnaden gibt. Himmel und Erde alle Menschen und Geschöpfe im Universum DEINER unendlichen Liebe rufen wir an, um mit ihnen DICH HERR und GOTT, unserem Vater Sohn und dem Heiligen Geist zu ehren, DICH zu loben und zu preisen.
Nimm DU, unser EIN und AllES, jeden TAG, alle Stunden und Sekunden unser Herz, die Sinne, und alles was wir sind und haben, als Dankgebet an, und mach es in unserer Zeit, in DEINEM Reich der Gerechtigkeit und des Friedens fruchtbar. Die Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es im Anfang war, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit.
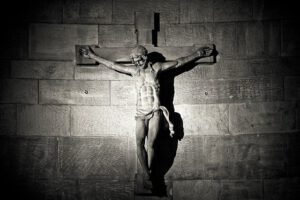
Kirchenlied
Alles unserm Gott zu
Ehren in der Arbeit in
der Ruh Gottes Lob
und Ehr zu mehren
Ich verlang und alles
tu unserm Gott allein
wir geben Leib und
Seel das ganze Leben
Gib o Jesu Gnad dazu
Gib o Jesu Gnad dazu
Alles unserm Gott zu
Ehren dessen Macht
die Welt regiert der
dem Bösen weiß zu
Wehren dass das Gute
mächtig wird Gott allein
wird Frieden schenken
seines Volkes treu gedenken
Hilf o Jesu guter Hirt
hilf o Jesu guter Hirt
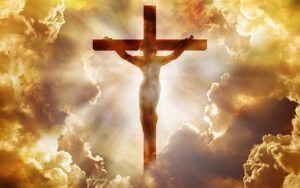
Bittgebet
O Gott unser Schöpfer
und Vater mit dem Sohn
unserem Herrn und dem
Heiligen Geist unserem
Tröster und Beistand
hilf uns glauben hoffen
bitten beten und aus
DEINER Liebe Leben
DIR danken für alles
was DU gibst weil DU
uns und was DU bist
in Zeit und Ewigkeit
Unendlich liebst sei
DU gelobt gepriesen
und gebenedeit auf
Erden und Himmel weit

Aus der Stille
Leben regt
sich aus der
Stille zu Wort
und Wille
Streift Geburt
und Tod die
Fülle Herr
und Gott

Anbetung
Vor aller Zeit, in unserer Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit bist DU, der „ICH BIN DER ICH BIN“ unser Herr und Gott. Wir verneigen uns in Demut und Ehrfurcht vor DIR, DEINEM Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist durch DEINE Gnade als den Schöpfer und Erhalter aller Gaben in DEINEM Universum. Heilig, heilig, heilig bist DU unser aller Vater, und geheiligt werde immerdar DEIN über alles erhabener Name. Lass DEIN Reich der Wahrheit, Gerechtigkeit und des Friedens, immer wieder neu bei uns ankommen, und hilf uns, dass wir DIR und einander in Treue dienen, damit DEIN Wille auf Erden wie im Himmel geschehe. Gib uns das tägliche Brot DEINER GÜTE, LIEBE und BARMHERZIGKEIT, damit unser Hunger und Durst nach DIR gestillt werden, und lass uns alle DEINE Gaben mit einander redlich teilen. Vergib o Gott unsere Schuld seid Menschen Gedenken und ermutige uns, dass auch wir durch den Tod Deines Sohnes, unseres Herrn und Meisters, die Vergebung annehmen und als Auferstandene im Herrn allen Menschen in DEINEM Namen vergeben. Guter Gott lass nicht zu, dass wir DEINE Fürsorge und Liebe missachten und in Versuchung geraten, uns als DEIN auserwähltes Volk fremden Göttern und Götzen unserer Zeit zuwenden, sondern erlöse uns von allen Übeln des Leibes und der Seele.
Denn DEIN ist alle Macht und Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit.

.
Über die Zeit
Heute lade ich Sie ein, mit mir über das Phänomen der Zeit nachzudenken, die für uns alle mit der Geburt beginnt, und einmal todsicher endet. Wir finden uns als Menschen mit anderen Lebewesen in einem zeitlichen Gefüge von Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft, im Kreislauf der Jahreszeiten und in einem kosmischen Geschehen vor, das mit Sicherheit einmal vor uns war, und nach uns existieren wird. Im Vergleich hiermit ist unsere individuelle Lebenszeit sehr kurz, und unser Gestaltungsraum wird durch die Endlichkeit des Daseins begrenzt. Mit unserem Tod geht aber unsere Zeit auf Erden endgültig zu Ende. Wir werden uns daher zu einem unbekannten Zeitpunkt unseres Lebens, von allen Beziehungen zu Menschen Lebewesen und Sachverhalten verabschieden müssen. Das Leben als Ganzes wird jedoch auch nach uns weiter gehen, und alle Ressourcen der Welt, unsere eigenen Werke und die kulturellen Leistungen der Menschen, werden die Nachkommen übernehmen. Das bedeutet: Nach unserem Lebensende werden die nächsten Generationen immer wieder einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter erleben. Auch das Geschehen in den kosmischen Räumen des Universums, und im makro- und mikrokosmischen Prozess der Natur, wird bleiben. Unsere Nachkommen werden das religiöse, kulturelle, technische und künstlerische Erbe der Menschen auf Erden übernehmen, verwalten, und den nachfolgenden Generationen anvertrauen.
Das Leben als Ganzes mutet uns daher zu, nachzudenken und unsere Lebenszeit zu nutzen, um das Erbe unserer Väter und Mütter nach Kräften treu zu verwalten, die Ressourcen zu schonen, um einmal alles mit einem liebevollen Blick der Sorge und des Wohlwollens, an unsere Nachkommen weiter zu geben. Wir haben das Geschenk des Lebens mit seinen Chancen und Grenzen einmal ebenso übernommen. und müssen uns fragen lassen, wie wir mit diesem Erbe umgegangen sind. Wir erleben die Zeit von Geburt an als unsere persönliche und gesellschaftliche Geschichte. Ohne uns dessen immer bewusst zu sein verabschieden wir jedes Jahr, jedem Tag, jeder Stunde, Minute und Sekunde als Teil unserer Lebenszeit. Der Fluss der Zeit ist nicht aufzuhalten. Die begrenzte Lebenserwartung scheint uns zu ermahnen, unser Leben so zu führen, dass wir uns einmal von Freude und Leid in der Zeit, verabschieden können. Ich rede mit Ihnen von Mensch zu Mensch über unser Leben in seiner begrenzten Zeit die todsicher endet. Wir finden uns alle in einem zeitlichen Gefüge von Vergangenheit Gegenwart und Zukunft im Kreislauf der Jahreszeiten und kosmischen Abläufen.
Entbunden von beruflichen. familiären und gesellschaftlichen Verpflichtungen bietet sich, wenn das eigene Einkommen gesichert ist, für Menschen nach der Berentung oder Pensionierung ein reiches Betätigungsfeld nach freier Wahl, im familiären, gesellschaftlichen und sozialen Umfeld an. Wie zu allen Zeiten besitzt die Weitergabe der Lebenserfahrungen im Austausch mit den jüngeren Generationen hohe Priorität. Mit dem höchsten Lebensalter und der damit zwangsläufig verbundenen körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen, engt sich der Bewegungs- und Aktionsraum erheblich ein. Im gleichen Maße stellt sich unvermeidlich eine vermehrte Abhängigkeit von anderen Menschen, die Erfordernis altersgerechten Wohnraumes, in einem sozialen und kulturellen Umfeld und ärztlicher und pflegerischer Betreuung ein. All diese Anpassungsleistungen bedürfen einer ständigen Wachsamkeit, kognitiven und emotionalen Bereitschaft, sich so zu verhalten, dass die individuelle Kreativität zur Anpassung an die neuen Lebenssituationen, und die kognitive und emotional angemessenen Reaktionen möglichst erhalten bleiben. Im hohen und höchsten Lebensalter ist mit der Zunahme zu beobachtender Todesfälle, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensende. und der damit gegebenen Umstände nicht zu vermeiden.
Diese Fragen haben mich motiviert, darüber nachzudenken, ob es Sinn
machen könnte, über eigene Lebenserfahrungen und die zu erwartenden Aufgaben zu reden, insofern sie als Aufgaben erkannt werden, die individuelle Erfahrungen übertreffen: Ich wage es daher mit Ihnen im Alter von sechsundneunzig Jahren auch über meinen zu erwartenden Tod, und die sich daraus für mich ergebende Sachlage, als einer der wie Sie nicht weiß, was im Tod und danach genau geschieht, zu reden. Vermutlich bin ich kein Einzelfall, dem es schwer fällt, über das geheimnisvolle Geschehen des Anfangs und Endes des Lebens nachzudenken. Es gibt mich seit über fünfundneunzig Jahren und ich weiß, dass ich mein Leben zu Ende leben möchte, wann immer das geschieht. Die Frage aber ist, ob ich und wir als Schicksalsgefährten bereit sind Geburt und Tod und die Lebenserfahrung näher anzuschauen: Unsere Geburt haben wir nicht bewusst erlebt wohl aber die Freude bei der Geburt unserer Kinder, und den Schrecken beim Tod geliebter Menschen. Was könnte es uns schwer machen, unseren eigenen Abschied vom Leben anderer und vom eigenen Leben zu bedenken? Könnte es sein, dass uns der Tod, als der endgültige Abschied von allem was unser Leben von Geburt bis in die gelebte Gegenwart Bedeutung und Sinn verlieh sehr schwer fällt. Die Angst taucht auf als ob alles, was unser Leben in der Zeit erfüllte, im Tod vernichtet würde. Dass es im eigenen Tod um einen endgültigen Abschied vom
Leben im bekannten Zeitraster von Vergangenheit Gegenwart und Zukunft geht, und unser individuelles Leben vernichtet würde. Was wäre aber wenn wir akzeptieren würden, dass unsere immer auch subjektive begrenzte Welterfahrung zwar mit dem Tod verabschiedet werden muss, und wir uns mit der Tatsache anfreunden müssen, dass die Welt und das Universum in seiner in Gesamtheit und Zeitstruktur, auch noch nach uns mit großer Wahrscheinlichkeit weiter bestehen wird? Was könnte es für uns und unsere Nachkommen bedeuten, wenn sie für uns der Sorge und wir mit unserem Tod der zeitlichen Sorge um uns selbst enthoben würden? Könnte die Vorausschau auf das sichere Ende unseres individuellen Lebens in der Zeit für uns im hohen oder höchsten Lebensalter ermuntern, all das nach Kräften in der verbleibenden Zeit zu umsorgen, was dem allgemeinen Leben nach uns förderlich wäre? Kann uns der christliche Glaube, wenn es um die ersten und letzten Fragen unseres Daseins in der Zeit geht ermutigen, den Abschied aus dem geschenkten Leben in der begrenzten individuellen Lebenszeit zu wagen. Wir Vertrauen unserem himmlischen Vater, der vor und jenseits aller Zeit in ewig liebender Gegenwart Himmel und Erde in ihrer Zeit erschaffen und erhalten, uns durch SEINEN eingeborenen Sohn erlöst, auch SEINE Zusage einhält, am Ende der Zeiten, den Gesegneten in einer neuen Schöpfung ewiges Leben zu schenken. Das Leben der Tod und die Auferstehung Jesu bedeutet dann, unsere Erlösung von Schuld und die Hoffnung dass der ewige Gott die Zeit, uns und alles was ER aus Liebe schuf zum ewigen Leben in einer neuem Schöpfung bestimmt. Jeder Wimpernschlag erfahrener, gestalteter und liebender Zuwendung, zu allen Menschen und Geschöpfen im Lebensgarten Gottes, schenkt uns die Freude in Standfestigkeit, Vertrauen, Glauben Hoffnung und Liebe, in der Zeit, und in dereinst ewig beim Vater, Sohn und Heiligen Geist in SEINER neuen Schöpfung im Reich des Vaters Sohnes und Heiligen Geistes in Frieden und Gerechtigkeit leben zu dürfen.

Berufung
Dreifaltiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, alles hast Du ins Dasein gerufen, uns von Ewigkeit in Dein Herz geschrieben und als »Getaufte« in Deine Kirche berufen. Du hältst Deine Schöpfung sicher über den Abgründen, vergibst den Völkern ihre Schuld, segnest Dein Werk und holst uns heim in Deinen großen Frieden. Geheiligt werde Dein Name! Staunend, andächtig und dankend preisen wir Dich, wenn Du Allmächtiger, uns Zeichen Deiner Herrlichkeit deutest. In der Stille unsere Häuser achten wir ein Leben lang auf Deine Weisungen. Rufst Du uns, dann jubeln unsere Seelen ihr »ad sum« und wir beten: »Öffne, Herr, Herz und Sinne, um Dir, den Menschen und all Deinen Werken zu begegnen. Lehre uns, wie Abraham zu glauben, Dich den Gekreuzigten und Auferstandenen, wie die Emmaus-Jünger zu erkennen, sorgsam und dankbar Dein Handeln auch in unserem Leben zu bedenken «:
Ein aus Lindenholz geschnitztes Kreuz, meines verehrten Großvaters, neben einem Bild Mariens mit dem Jesus-Kind, ist in unseremWohnzimmer nicht zu übersehen. Ursprünglich war der leidende Herr an einem Kreuz in Gestalt eines Weinstockes mit Rebzweigen und Trauben befestigt und hing in der Wohnung der Großeltern. Es begleitet meinen Lebensweg von Kindheit an. Tiefes Erbarmen überfällt mich oft, wenn ich zum Herrn emporblicke, der in Schmerzen gekrümmt, mein ohnmächtiges Schweigen mit den Worten füllt: »Für alle; auch für Dich, Franz! « Betete die betagte Großmutter den Rosenkranz, las sie in der Heiligen Schrift, segnete sie mich mit Weihwasser zur Nacht oder empfing sie die Krankenkommunion, warst Du Herr uns nahe. Wenn die Ordensschwestern im Kindergarten mit uns beteten und sangen, der Pfarrer uns vom Leben, Tod und Auferstehung Jesu, der weltweiten katholischen Kirche und den vielen Glaubenszeugen erzählte, oder Gottesdienste mit uns feierte, fühlten wir Kinder uns auch im Krieg und den Notzeiten danach, im Schutze Gottes geborgen. In sicherer Obhut und im Wissen, zur heiligen Familie zu gehören, blieb die St. Josefskirche in Rheinfelden mit der Marienkapelle bis zum heutigen Tag, meine erste geistliche Heimat. Sie hat sich in stillen Stunden der Anbetung tief in meine Seele eingeprägt. In der weltweit geöffneten Katholischen Kirche erfahre ich immer wieder Hilfe und Zuspruch und mein Glaube sagt mir, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Ich betrachte es als Führung und Gabe Gottes, aufrechte undfromme Priester und Gläubige zu kennen, die mir den katholischen Glauben vorbildlich vermittelten. Sie halfen mir, Gott in allen Dingen, der Schrift, Liturgie, den Sakramenten, der Natur, Kunst, Musik und Literatur zu erfahren. Im Kindesalter ließ ich mich in feierlichen Gottesdiensten, tief beeindruckt von den Gesängen und Gebeten der Gemeinde mittragen, in stürmischer Adoleszenz, trösten undaufrichten. Dich, Herr, erlebte ich auch dankbar gegenwärtig, wenn mich in späteren Jahren, Fragen, Sorgen, und das Leid der Menschen berührten, oder, wenn ich deren Freude, Hoffnung und Glaubenstreue erleben durfte.
Deine gütigen Engel, Herr, schützten und bewahrten mich in vielen Gefahren während des Krieges und den Hungerjahren danach. Immerwieder erfuhr ich in Notsituationen Beistand: Es gab fromme Frauen, die für mich beteten und Männer, die mich berieten und unterstützten. In der eigenen Familie, unserer Verwandtschaft, und bei Nachbarn, lernte ich im liebenden Miteinander christliche Fürsorge kennen. In unserer Stadt kannten sich die Menschen und teilten in schwierigen Zeiten die geringen Vorräte unter sich. Ohne ernstlich Schaden zu nehmen überstand ich im Krieg einen bedrohlichen Tieffliegerangriff, die riskante Flucht aus einer Kaserne, einen Kampfeinsatz in den letzten Kriegstagen, die Gefangenschaft und den gefährlichen Fußmarsch nach Hause. Ich habe den »guten Begleitern« bis zum heutigen Tag viel zu verdanken. Nach dem Ende einer längeren Beziehung, gab es für mich zeitliche Freiräume: Ich begann mich mit politischen und religiösen Themen zu beschäftigen. In der Leitung eines Katholischen-Vereins zur Beratung und Betreuung Jugendlicher, gelang es unseren Pfarrer zu entlasten. Als Vorsitzender einer Wählervereinigung und Stadtrat gewann ich vielfältige Einblicke in kommunale Entscheidungsprozesse. Die ständigen Enttäuschungen mit handelnden Personen und die Konfrontation mit wahltaktischen Strategien zur Meinungsbildung führten dazu, dass meine kommunalpolitischen Interessen abnahmen. Ich erkannte erhebliche Schwachstellen in den Voraussetzungen politischer Diskussion: Es mangelte in unserer Gesellschaft offensichtlich an einer ernstlichen Auseinandersetzung mit Werten, Normen, sozialen-, ethischen-, philosophischen-, religiösen und Sinnfragen. Bei der Suche nach Lösungen, begegnete ich immer mehr christlichen Konzepten. Ansprechpartner in diesen Fragen, waren die örtlichen Geistlichen und ein Stadtrat der CDU. Je mehr sich der Eindruck verstärkte, dass mich politische Fragen nicht mehr so stark interessierten, desto unsicherer wurde ich, ob ich mit der Übernahme dieser Aufgaben auf dem rechten Weg bin. Auf der Suche nach Alternativen, beschäftigte ich mich zunehmend mit christlicher Literatur. Zeitweise studierte ich fast ausschließlich die Heilige Schrift. Es entstanden in diesem Zusammenhang Fragen, die sich nicht mehr so leichthin abweisen ließen:
Ich meldete mich aus diesem Grund zu Exerzitien im Kloster Beuron an. In der Ruhe dieser Tage erhoffte ich mir klarer zu werden, welche Aufgaben mir im Hinblick auf das bisherige und künftige Leben wichtig wären und welche Ziele ich erreichen wollte. Den Aufenthalt in einem Kloster hatte ich gewählt, um den eigenen Standort als katholischer Christ im Licht meiner Glaubensüberzeugung zu überprüfen. Der vorgegebene zeitliche Rahmen zwischen anregenden
Geborgen im Glauben Hoffen und Lieben.Vorträgen, Schweigen, Mahlzeiten, Erholungsphasen und Gottesdiensten, kam meinem Anliegen sehr entgegen. Das Kloster mit den vielen Mönchen, Brüdern, der Liturgie und den zur Besinnung einladenden Räumen, erlaubte es, Alternativen zum bisherigen Leben zu prüfen. Ich kann es nicht beweisen, hatte aber den Eindruck, dass die Benediktiner in dieser Woche auch für uns beteten. Zu unserer Gruppe gehörte ein blinder Teilnehmer. Es ging mir besonders zu Herzen, wenn er bei den Gottesdiensten an einer kleinen Hausorgel Platz nahm und unsere Gesänge begleitete. Waren wir doch alle mit persönlichen Anliegen gekommen, wie Blinde, die weitergeführt werden wollten. Von Kindheit an, kannte ich die Bereitschaft, auf Eingebungen Gottes zu lauschen. Dieses kindliche Vertrauen, dass Gott unsere Wege kennt und uns lenken kann, tauchte wieder auf. Am Ende dieser Woche war ich kein anderer Mensch. Es war auch nicht so, dass ich zu allen Fragen Lösungen entdeckt hätte. Ich hatte aber erlebt, wie tröstlich es ist, wenn mehrere Menschen sich in »Gottes Namen« zusammenfinden, um zu beten und zu singen. DieBereitschaft im Gebet, in der Schriftlesung und Liturgie die Nähe zu Gott zu suchen, begleitete mich in den Alltag. Die aufrüttelnde Erfahrung, zu erkennen, wie wichtig Priester sind, um Eucharistie zu feiern und die Frage, ob und wie ich auf einen solchen Anspruch reagieren könnte, ließ mich nicht mehr los:
Wieder zu Hause, eingebunden in die beruflichen, sozialen und politischen Aufgaben, suchte ich immer wieder die Stille, um mich mit Aspekten priesterlichen Dienstes in der Kirche vertraut zu machen. Zum Glück hatte ich von frühester Jugend an glaubenstreue Priester erlebt. Nun beschäftigte mich die Frage, was diese Menschen motivierte, sich von der Kirche in Dienst nehmen zu lassen. Ich interessierte mich für deren Aufgaben, las Berichte und Geschichten über das Wirken von Missionaren. Es fiel mir in diesem Kontext wieder ein, dass einst Pfarrer Dold mich als Junge gerne in der Priesterausbildung gesehen hätte. Sein Plan scheiterte aber am Widerstand meiner Mutter. Die Kirche als weltweite Gemeinschaft der Gläubigen mit ihrer Struktur, den Bischöfen, Kardinälen und dem Papst kamen in den Blick. In politischer Arbeit geschult, begann ich für alle, die als schwache Menschen, wie ich, der Kirche dienten, zu beten. Die geschichtliche Dimension der Kirche, ihr Weg durch die Zeit und ihre aktuelle Gestalt, beschäftigte mich sehr. Ich erkannte das notwendige Gegengewicht der Kirche zu den Zeitströmungen. Alles, was mir von Kindheit an lieb und teuer war, schien mir ohne die Stimme der Kirche in Gefahr. Noch mehr: Ich sah viele Menschen bedroht, der Gottlosigkeit zu verfallen. In meiner Not und aufbrechenden Sorge um deren Seelenheil, griff ich vermehrt zur Heiligen Schrift. Ich fühlte mich durch Gottes Wort sehr angesprochen. Da redete »Einer«, der die Menschen kannte, der Herr, wahrhaft, vertrauenswürdig und mit Macht. Mir gingen die Texte so unter die Haut, dass ich mich schwer davon lösen konnte. Ich war der Auffassung, nichts Besseres finden zu können. Immer wieder hörte ich die Stimme des Herrn, dass er Arbeiter in seinem Weinberg brauche.Zusehends beschäftigten mich Begegnungs- und Berufungsszenen: Der kleine Zachäus, der auf den Baum stieg, um den Herrn zu sehen, Jesu Gespräch mit der Sünderin, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, der Schächer am Kreuz, die Verleugnung des Petrus, die Auferstehung Jesu und der ungläubige Thomas, die Begegnung mit den Emmaus Jüngern. Ich verfolgte den Lebens- und Leidensweg des Herrn, Jesu Tod und Auferstehung. Die Gestalt des Herrn beeindruckte mich immer mehr. Gleichzeitig fühlte ich mich sehr unwürdig, ihm als Priester nachfolgen zu können. Es tauchten Fragen auf: Könnte ich mich getäuscht haben? Ich befand mich ja schon im fortgeschrittenen Alter. Habe ich die Fähigkeiten, die nötig sind, um das Abitur nachzuholen und ein Hochschulstudium zu absolvieren? Wie kann ich ein langes Studium finanzieren? Wer wird meine Mutter versorgen, wenn ich außer Haus bin? Ich stand einer Fülle ungelöster Probleme gegenüber. Immer, wenn ich an den Herrn dachte und das, was er für uns getan hat, wurde es mir warm ums Herz. Über Monate hinweg hatte ich nicht den Mut, mit anderen Menschen über das zu sprechen, was mich zutiefst umtrieb. Schließlich wagte ich es doch, unseren Pfarrer über meine Überlegungen und Pläne zu informieren. Im Unterschied zu unserem damaligen Vikar, den ich ebenfalls ansprach, reagierte unserlebenserfahrener Pfarrer ruhig und besonnen. Mit Rücksicht auf mein bisheriges Leben, lag ihm sehr daran, mich vor unüberlegten Schritten zu warnen. Ihm gegenüber war es aber möglich, offen zu sprechen und mitzuteilen, dass mich die eigene religiöse Entwicklung ebenfalls überraschte und ich mir eine zweijährige Frist setzte, um die sich anbahnende Entscheidung so weit es möglich war, zu prüfen. Ich war froh, in unserem Pfarrer, meinem Beichtvater, einen Freund zu haben, mit dem ich über alles reden konnte.
Ich begann nun immer mehr, mich ernstlich zu fragen, auf was ich mich einstellen müsste, wenn ich in der gegebenen Situation und in meinem Alter Priester werden wollte. Mir schien eine redliche Selbstprüfung angezeigt und ich hoffte, dass ich, nach einer Frist von zwei Jahren, je nach Ausgang dieser Erfahrungen, leichter entscheiden könne, ob ich es wagen könnte, das Ziel des Priesterberufes anzustreben. Ein Priester muss zum Beispiel morgens aus den Federn kommen. Mir schien das ein erstes Kriterium zu sein, um mich zu prüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Von da ab begann ich, vor Antritt meiner täglichen Arbeit als Baukaufmann, die Frühmesse zu besuchen. Es waren nie viele Gläubige anwesend nur einige Frauen, deren Frömmigkeit mich beeindruckte, und unser Pfarrer, der mir sehr vertraut war. Ich möchte keinen dieser Gottesdienste missen. Ähnlich wie mit 12 Jahren in der kleinen Kapelle in Giersbach mit dem »Hotzenbischof«, waren wir eine kleine Herde. Wenn ich in der Dunkelheit und Ruhe frühmorgens die zehn Minuten Fußweg durch die Stadt zur St. Josefs-Kirche ging, war dieses schweigende Gehen wie erfüllt von Gottes Gegenwart. Ich war mit mir und meiner Absicht, Priester zu werden, einfach glücklich. Vor dem Ende meiner selbst gewählten zweijährigen Probezeit, hatte sich der Wunsch, noch Priester zu werden, gefestigt. Mir war klar, dass es mit Sicherheit kein leichter Weg werde. Ich machte mir auch Gedanken darüber, welche Zeit mir nach einem Studium bliebe, um als Priester zu wirken.
Immer wieder setzte sich der Gedanke durch, dass ich von Gott alles, empfangen habe und dass der Herr sein Leben für uns Menschen hingegeben hat. Manchmal überlegte ich mir, dass sich jeglicher Einsatz lohnte, wenn ich auch nur einmal als Priester ein Messopfer feiern würde. Während der ganzen Zeit der Vorbereitung, befand ich mich in regelmäßigem Austausch mit unserem Pfarrer und dem damaligen Vikar. Ihre Begleitung und das Gebet frommer Frauen in den täglichen Gottesdiensten, erlebte ich wie einen Raum der Stille und Zuwendung, in dem Gott selber auf Seine Weise wirkte. Ich konnte auf zwei Jahre zurückschauen, in denen mit Gottes Hilfe einiges geschehen war: Trotz meiner umfangreichen Tätigkeit im Beruf, im sozialen und politischen Umfeld und beim Musizieren, war es mir möglich, wochentags die Frühmesse zu besuchen. Dies war auch der Fall, wenn ich spät zu Bett kam. Es war mir wichtig, mein Studium weitgehend aus Eigenmitteln zu finanzieren. Die Ersparnisse, insbesondere aus meiner Nebentätigkeit als Schlagzeuger, waren so bedeutend, dass ich, wenn ich zusätzlich mein Instrument verkaufen würde, die Kosten bis zum Abitur aus eigener Tasche bezahlen konnte. Ich betrachtete auch die Tatsache, dass ich keine feste Beziehung zu einer Frau hatte und dass ich in den zwei Jahren als nebenberuflicher Musiker, trotz den Begegnungen mit vielen schönen Frauen, bei meinem Entschluss bleiben konnte, als einen Hinweis, der mich hoffen ließ, auch den geforderten Zölibat halten zu können. Ich wusste zwar nicht, ob ich das Abitur schaffen würde und in der Lage wäre, unter anderem noch Latein und Griechisch zu lernen. Es war mir bewusst, viel arbeiten zu müssen, um diese Hürde zu nehmen. Mit Blick auf bisher gelöste Aufgaben im Beruf, der Politik und im sozialen Bereich, durfte ich aber damit rechnen, dass sich diese Fähigkeiten auch in der Schule bewähren würden. Alles andere konnte ich ja getrost Gott und SEINEN guten Engeln überlassen. Hatte mich doch der Herr in meiner Jugend und im bisherigen Leben, in der Familie, der St. Josefs-Pfarrei, bei Verwandten auf dem Hotzenwald, in den Kriegsjahren und in schwierigen Zeiten danach, beschützt und vor Schaden bewahrt. Das Beispiel frommer Priester, Männer und Frauen, bestärkte mich im Glauben. Deren Glaubenszeugnis im beruflichen und sozialen Umfeld, im Mitvollzug der Eucharistie und den liturgischen Handlungen, halfen mir, die Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche zu festigen. Ich ging davon aus, dass auch meine beruflichen Erfahrungen, die Leitung einer Wählervereinigung und des Katholischen-Männer-Fürsorgevereins. sowie die Tätigkeit als Stadtrat und in den verschiedenen Ausschüssen, für die künftige Arbeit in einer Pfarrgemeinde nützlich sein könnten. Dies galt auch für die Einschätzung der eigenen Kräfte und den verantwortlichen Umgang mit der Gesundheit. Das vermehrte Studium religiöser Literatur, vor allem der Heiligen Schrift, und die nach dem Aufenthalt im Kloster Beuron fortgesetzte Klärung der Berufungsfrage sowie das wachsende Interesse an Aufgaben der Kirche, deren Strukturen und die vielen Hilfen, die mir durch sie zuteil wurden, bestärkten mich in der Gewissheit, dass wir Priester und die Kirche brauchen, um Eucharistie zu feiern und ein Gegengewicht zu atheistischen Zeitströmungen herzustellen, und um Menschen vor der Gottlosigkeit zu bewahren. Nachdem ich mir über meine religiöse Entwicklung und die aktuell gewonnenen Einsichten klar geworden war, drängte es mich, nicht mehr zu schweigen, sondern die wichtigsten Personen über die sich anbahnende Entscheidung zu informieren. Dies betraf die politischen Freunde, die Mitarbeiter im Sozialdienst, meinen Arbeitgeber, den Bürgermeister, meine Familie, die Verwandten,persönlichen Freunde und einige wichtige Nachbarn. Es begegnete mir in diesen Gesprächen, teils Überraschung, aber auch respektvolles Verstehen-Wollen.
Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung im Spätberufenen-Seminar St. Pirmin in Sasbach war begleitet von Fragen, Unsicherheit und Hoffnung. Ich hatte unseren Bürgermeister gebeten, den Stadtrat erstüber meine Absicht zu informieren, wenn mir die Bestätigung, zur bestandenen Prüfung vorliege. Er hielt sich aber nicht an diese Absprache. Zum Glück bestand ich die Prüfung am selben Tag, an dem ich wunschgemäß als Stadtrat von Rheinfelden aus dem Gremium ausschied. Ein erstes Ziel war mit Gottes Hilfe erreicht. Ich schaute auf zum Kreuz meines Großvaters, zu all denen, die diesen Weg vor mir gegangen waren und wartete mit großem Interesse auf den Tag, ab dem ich im Spätberufenen-Seminar St. Pirmin in Sasbach wohnen und arbeiten würde. Über die segensreiche Zeit in St. Pirmin werde ich mich in einem nächsten Beitrag äußern.

Bitte
Herr verrichte
Dein Gebet in
uns damit wir
Deinen Willen
zum Wohl
der Brüder
Und
Schwestern
erfüllen
In der Liebe
zu DIR und
zu einander
Stillt DEINE
Gnade die
Sehnsucht
Nach DIR
gelobtund
gepriesen
seist
DU hier
allezeit und
in Ewigkeit
